|
T3:2008 - Antrieb TRIX-T3;
Ist-Zustand und kleine Verbesserungen
(von Herbert Haun, 12.2008)
| Um dem geneigten Leser
etwas halbwegs Objektives zu den Fahreigenschaften der TRIX-T3
(und auch der Schwestermaschine von FLEISCHMANN) anbieten zu
können, haben wir einen einfachen Testring aufgebaut. Halbwegs
objektiv insofern, als bei der derzeitigen Antriebstechnik aller
Hersteller durchaus Serienstreuungen auftreten und wir beim Kauf
also Gut- und leider auch Nicht-ganz-so-gut-Läufer erwischen
können. Glücklicherweise können wir als
Modellbahn-Begeisterte vieles noch optimieren...
Analog betrieben, kann die
Fahrspannung über ein Voltmeter korrekt eingestellt und
bestimmt werden. Eine Stoppuhr hilft bei der Bestimmung der
Fahrgeschwindigkeit. Nicht polarisierte Roco-Weichen, gerade und
im Abzweig befahren, geben Aufschluss über die Qualität der
Stromabnahme.
ZIMOs Handheld-Zentrale MX31ZL
ermöglicht das Ausloten der Fahreigenschaften-Optimierung über
moderne Decodertechnik.
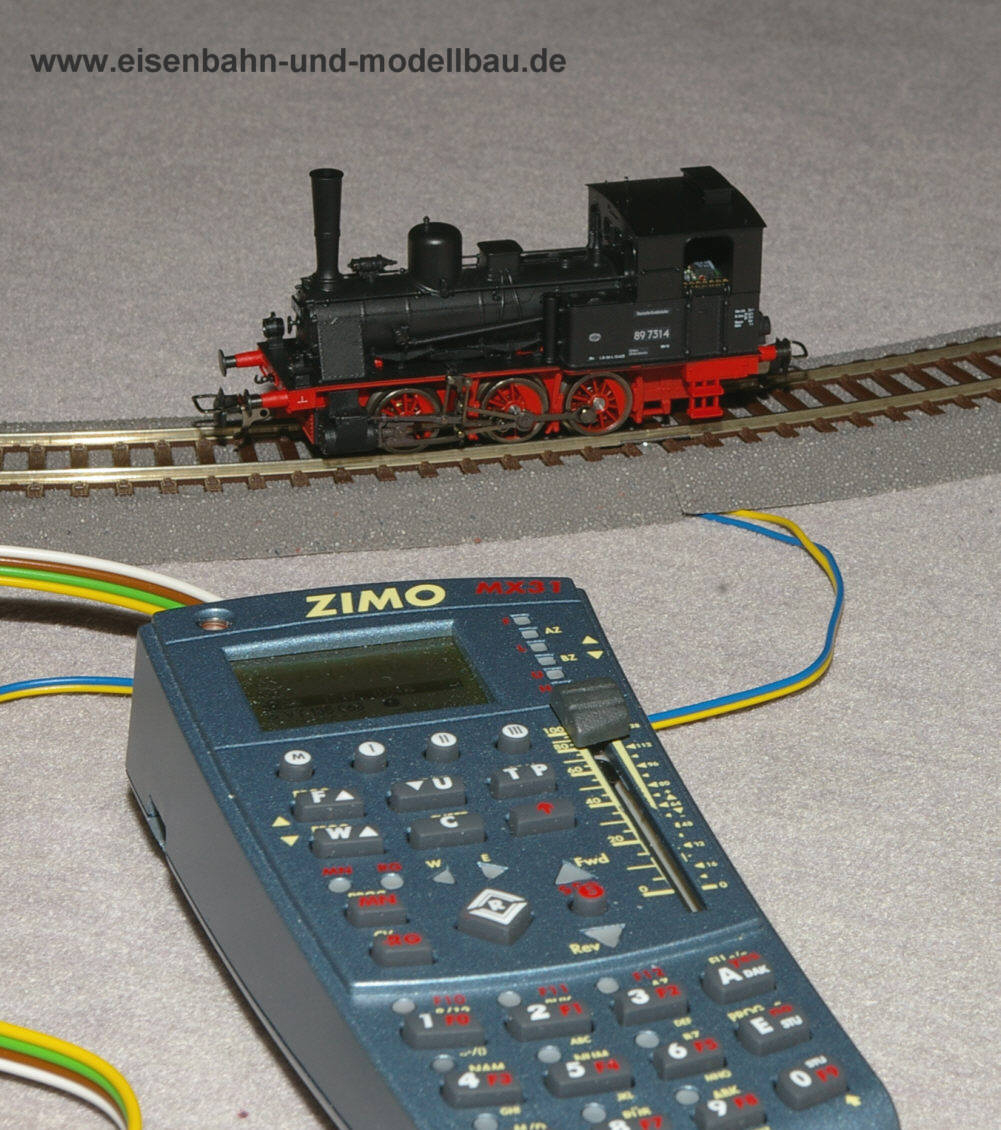
|

Zum
Seitenanfang
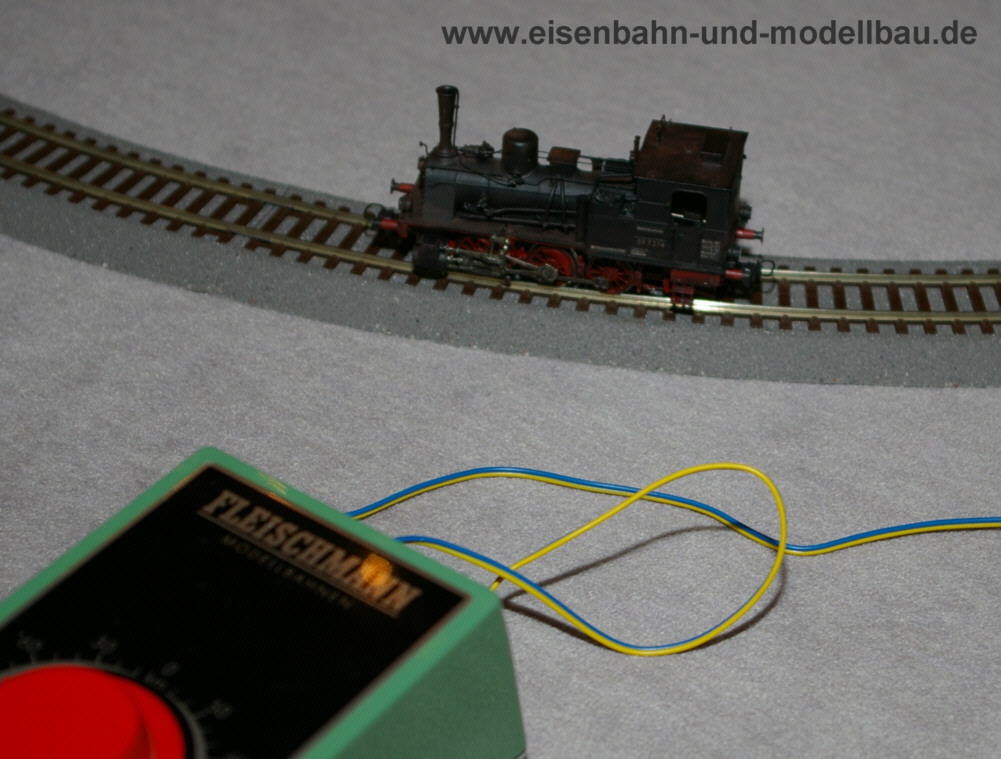
Zum
Seitenanfang
|
Maß
(Maße in km/h -
umgerechnet 1:87) |
Vorbild
|
Umbau-
Modell RÖWA / GFN von 1989 |
TRIX
22121
von 2004
(89 7314) |
TRIX
22767
von 2006
(MFP
Nr. 3) |
GFN
401001
von 2008
(89 7498) |
TRIX
22146 von 2008 mit
Gräler-Rädern
(89 7422) |
Geschwindigkeit
vorwärts bei 12 V |
40
km/h |
79
km/h |
148
km/h |
145
km/h |
83
km/h |
147
km/h |
Geschwindigkeit
rückwärts bei 12 V |
40
km/h |
79
km/h |
148
km/h |
124
km/h |
83
km/h |
147
km/h |
| Anlaufspannung
vorwärts |
|
3,5
V |
4,0
V |
4,1
V |
3,6
V |
4,3
V |
| Anlaufspannung
rückwärts |
|
3,5
V |
4,0
V |
4,0
V |
3,5
V |
4,3
V |
| Anhalteweg
aus 12 V |
|
30
mm |
0
mm |
0
mm |
100
mm |
0
mm |
|
Ziemlich erschreckend
sind die so ermittelten Werte. Die TRIX-Maschine ist mehr als
3,5fach so schnell wie ihr Vorbild, und das bei Nennspannung 12
Volt! Bei aufgedrehtem Analog-Trafo ist "noch mehr
drin". Der Anhalteweg ist dabei nicht messbar. Der etwas
langsamere Rückwärtsfahrt-Wert der Lok von 2006 lässt auf
einen leicht verdreht sitzenden Kollektor (Fertigungstoleranz am
Motor) schließen.
Zwar ist auch die Fleischmann-T3
mehr als doppelt so schnell "wie erlaubt", aber
immerhin zeigt sie etwas Auslauf - immerhin 10 cm aus vollem
Lauf. Interessant, dass der vor 20 Jahren optimierte
Fleischmann-Antrieb (s. EMB 24)
nicht allzuviel besser ist als die Lok von 2008 ohne
Optimierung.
Zum
Seitenanfang
|
| Bei den kleinen dreiachsigen Loks
ist die Stromabnahmebasis kurz, trotz der Tatsache, dass keine Haftreifen da
sind und so alle Räder ihren Anteil am Transport der Antriebsenergie haben
sollten. Wunder in Richtung gleichmäßigen Dahinschwebens über Weichenstraßen
erwarten wir somit nicht, aber wir möchten natürlich auch rangieren oder mit
mäßiger Geschwindigkeit aus dem Bahnhof rollen; klappt das mit der
Fleischmann-T3 |
wegen des geringfügigen Auslaufs noch relativ gut, so bereitet
uns die TRIX-T3 in dieser Hinsicht keine Freude. Standhaft im wahren Wortsinne
zeigt sie sich unpolarisierten Herzstücken und leicht verschmutzten Gleisen
gegenüber.
Um der Sache auf den Grund
zu gehen, ist ein "Blick unter die Haube" angebracht. |
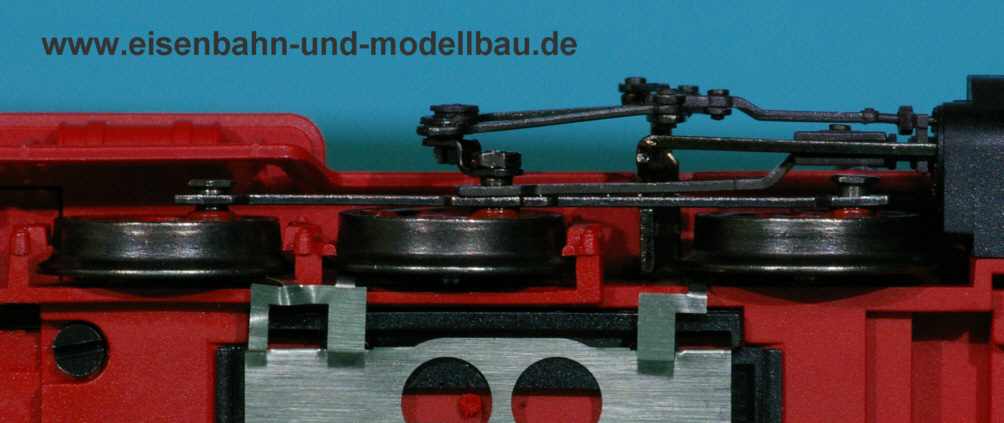
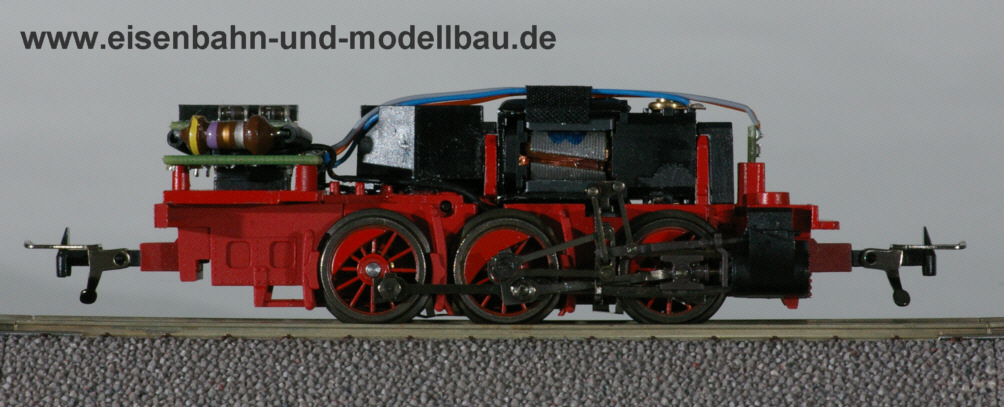
|
Das
tun wir hier bei der TRIX-T3, denn da ist erst einmal der größte
Handlungsbedarf - in drei Punkten: Stromabnahme, Geschwindigkeit und
Auslauf.
An den Antrieb der TRIX-T3
gelangt man auf einfache Weise: unter dem Fahrwerk der kleinen Lok ist
eine gut zugängliche Schraube (ganz links unten im Bild) angebracht.
Nach dem Herausdrehen hakelt das Fahrwerk nur noch geringfügig im
Gehäuse, und mit ein wenig Gefühl sind die beiden Baugruppen schnell
getrennt. Aber Achtung: beim im Jahr 2008 gekauften Modell (DRG-Ausführung
22146) ist der Schraubenkopf ein wenig zu groß und klemmt in seiner
Bohrung in der Getriebeabdeckung. Wenn die Schraube herausgedreht wird, zieht
sie die Getriebeabdeckung gewaltsam nach unten, was
Verbiegungen und im schlimmsten Fall Schäden an Rastnasen des Umlaufs
nach sich ziehen kann. Hier muss vorsichtig schrittweise vorgegangen
und die Getriebeabdeckung Stück für Stück wieder zurückgedrückt
werden, bis der Schraubenkopf frei kommt.
Nach dem Abnehmen des
Gehäuses wird der Blick auf den sauber strukturierten Antrieb frei. Von vorn nach hinten
finden wir die
LED-Spitzenbeleuchtung, den fünfpoligen,
schräg genuteten Motor (Kollektor voraus), das
Schnecken-Stirnrad-Getriebe mit abgeschrägtem Getriebe-Gehäuse und die
Elektronikplatine mit der LED-Schlussbeleuchtung und 21poliger
Decoder-Schnittstelle.
|
Ein
paar Worte zum Antriebskonzept. Der Konstrukteur einer
Modellbahnlokomotive sieht sich vielerlei Zwängen ausgesetzt:
Das Modell soll aus möglichst wenigen, einfach zu fertigenden
Bauteilen bestehen, es soll sich schnell und sicher montieren
lassen, dennoch ein gewisses Minimum an Servicehandlungen
ermöglichen, und das ganze auf dem Raum, den die
maßstabsgerecht verkleinerte Silhouette des Vorbilds abzüglich
der Wandstärken, Radsatz-Innenmaße und ähnlicher Ekligkeiten
erlaubt. Ordentlich laufen muss das Ganze auch noch.
"Geht nicht,
gibt's nicht" sagen die Produktmanager, und fähige
Ingenieure stellen sich der Herausforderung. Dabei entstehen
Kompromisse. Erinnern wir uns
an die Fleischmann-T3 des Jahres 2008:
Als die Lok konstruiert wurde,
gab es noch keine Digitaldecoder, die in das Fahrzeug gepasst
hätten; als es sie gab, klebte man Vorhänge in die Fenster und
hängte die Elektronik unter das Dach des Führerhauses. Also
setzten die Konstrukteure den relativ leichten Flachmotor in das
hinten weit überhängende Führerhaus und platzierten ein
ordentliches Kesselgewicht über die Antriebsachsen: gute
Fahreigenschaften.
Folge: die von Fleischmann
nachträglich hineingebastelte achtpolige Decoderschnittstelle
baumelt sichtbar im Führerhaus herum. |
Zum
Seitenanfang

Zum
Seitenanfang
|
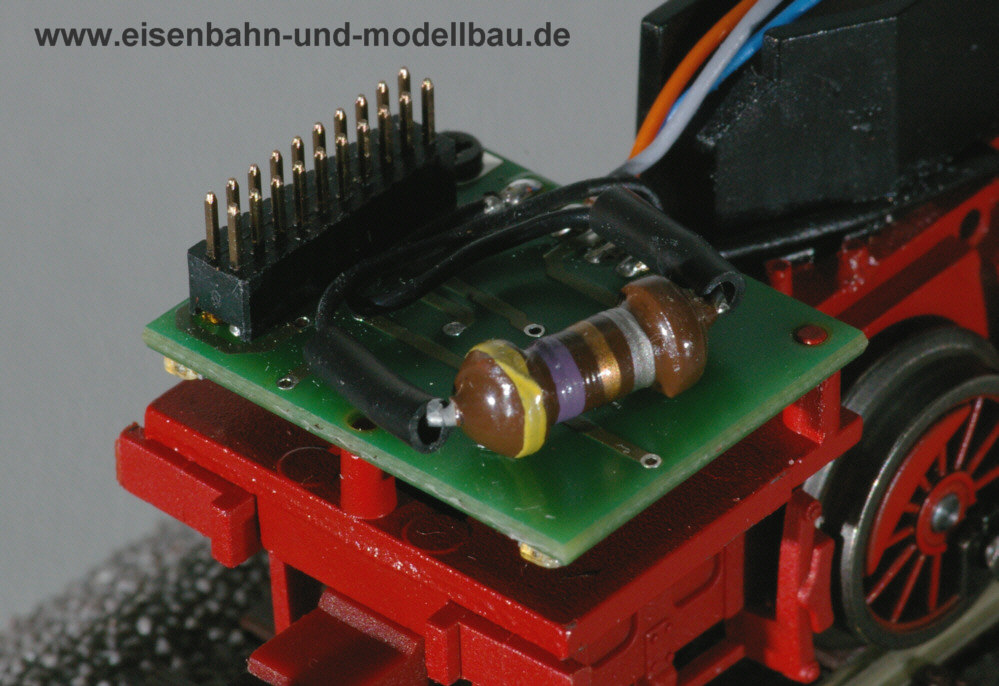
Wohin dann aber mit dem Motor? Da
hieß es dann wohl "Ab in den Kessel!".
Glücklicherweise gehört das Metallgehäuse zur Märklin/TRIX
Tradition, so dass die Lok dennoch ein vernünftiges Gewicht
bekommt.
Nun kann man Metall nicht
beliebig dünn gießen, wenn sich die Form- und
Produktionskosten im Rahmen halten sollen. Für den Motor
bleiben somit nur gut neun Millimeter Breite übrig! Die Folge:
Keine Schwungmasse, kein freier Kesseldurchblick, Auslauf beim
Strom Wegnehmen gleich Null. Da hätte auch eine Schwungmasse
von neun Millimeter Durchmesser nichts mehr gebracht.
Zieht man das Getriebegehäuse
zwischen Motor und Elektronikplatine ab, so findet man eine zweigängige Schnecke. In Zusammenarbeit
mit den übrigen, exakt im Rahmen gelagerten Zahnrädern bringt
sie es auf eine Gesamtübersetzung von 25:1. Schlanke Motoren
haben eine hohe Drehzahl, hier so rund 20.000 Umdrehungen pro
Minute bei 12 V, und damit kommen wir trotz der zu kleinen
Lokräder auf die knapp 150 km/h aus der Tabelle oben. |
Die
TRIX-Konstrukteure sind einen anderen Weg gegangen.
Offensichtlich hatten sie die Vorgabe, die gewaltige 21polige
Schnittstelle, die funktionshungrige Modellbahner zufrieden
stellen soll, in die kleine Lok zu bekommen - sie ist wohl
Hausnorm geworden, auch wenn sie den Platz für eine
fernsteuerbare Rangierkupplung oder ähnliche Gimmiks wegfrisst
und sich so selbst ad absurdum führt.
Nun geht es dabei ja
nicht nur um die Stiftleiste, sondern auch um den Freiraum für
den recht voluminösen Decoder, der dazu gehört. Der einzige
Platz dafür findet sich im Führerhausboden. Dort liegt dann
auch die große Funkentstördrossel herum, die die aktuelle
Normenlage wohl erzwingt, wenn konventionelle
Gleichstrom-Motoren mit ihrem Bürstenfeuer verbaut
werden.
Zum
Seitenanfang

Zum
Seitenanfang
|
|